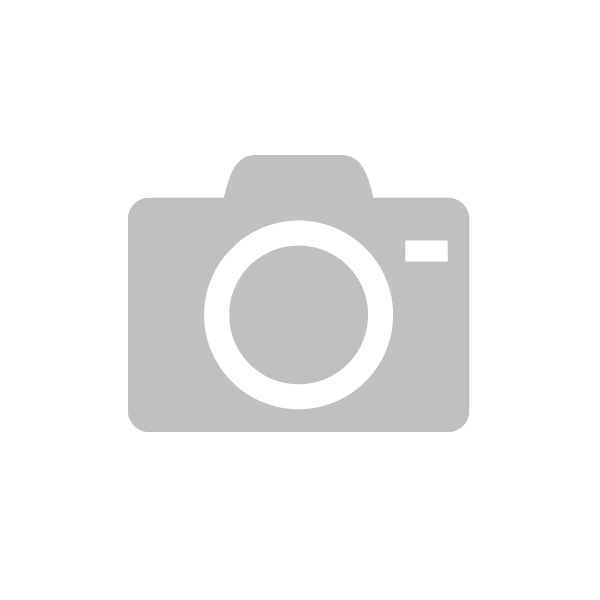Diese Webseite verwendet Cookies (Webanalysedienst: Matomo, sowie Sessioncookies). Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung dieser Cookies einverstanden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Datenschutz.

Typ:
Handschrift (Band mit mehreren Werken)
Hauptsachtitel:
Antithesis Christi et Antichristi (Jenaer Hussitenkodex)
Förderer:
Vorbesitzer:
Vorgängerorganisation:
Format:
32 x 21,5 cm
Umfang:
114 Bl.
Entstehungszeit:
um 1500
Entstehungsort:
Böhmen
Schreibsprache:
Latein
Beschreibstoff:
105 Bl. aus Papier; 9 Bl. aus Pergament
Kodikologie:
Sammelband bestehend aus neun handschriftlichen Teilen sowie einer Inkunabel zum Thema Hussitische Revolution in Böhmen, mit zahlreichen Miniaturen als Bild-Antithesen; Text größtenteils alttschechisch, Folio 1 - 5 lateinisch
Der Jenaer Kodex hat insgesamt 114 Blätter, davon 105 aus Papier und 9 aus Pergament. Auf Papier ist auch die erwähnte Inkunabel gedruckt; einige Blätter stehen leer. Den Band leitet ein Gedenkvermerk auf fol. 1r ein, der offenbar festlicher Art war, wie schon die Schriftgröße erkennen lässt. Der Vermerk lautet: Bohuslaus de /... sue cau/sa memorie manu / propria me fecit. Das nachträglich ausradierte Wort kann heute als Czechticz ersetzt werden, so dass die ganze Inschrift, ins Deutsche übersetzt, folgenden Wortlauf hat: Bohuslaus von Cechtice hat mich mit eigener Hand zu seinem Andenken geschaffen. Unter dieser Inschrift ist ein geläufiger kleiner Kursiv der Titel hinzugeschrieben, der anscheinend den ganzen Band charakterisiert: Antithesis Christi et Antichristi / Odpornost Kristova s Antikristem.
Der Jenaer Kodex hat insgesamt 114 Blätter, davon 105 aus Papier und 9 aus Pergament. Auf Papier ist auch die erwähnte Inkunabel gedruckt; einige Blätter stehen leer. Den Band leitet ein Gedenkvermerk auf fol. 1r ein, der offenbar festlicher Art war, wie schon die Schriftgröße erkennen lässt. Der Vermerk lautet: Bohuslaus de /... sue cau/sa memorie manu / propria me fecit. Das nachträglich ausradierte Wort kann heute als Czechticz ersetzt werden, so dass die ganze Inschrift, ins Deutsche übersetzt, folgenden Wortlauf hat: Bohuslaus von Cechtice hat mich mit eigener Hand zu seinem Andenken geschaffen. Unter dieser Inschrift ist ein geläufiger kleiner Kursiv der Titel hinzugeschrieben, der anscheinend den ganzen Band charakterisiert: Antithesis Christi et Antichristi / Odpornost Kristova s Antikristem.
Anmerkung:
Einsicht in die DIGITALISATE unter:
http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NMP___IV_B_24_____3TQMIOE-cs
http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NMP___IV_B_24_____3TQMIOE-cs
Bestand:
Projekt(e):
Bibliotheca Electoralis
Gattung:
theologischer Text
besitzende Institution:
Signatur(en):
IV B 24
ehemalige Signatur (Jena): Ms. El. f. 50b
Geschichte:
Der Sammelband entstand im Auftrag des Prager Bürgers Bohuslav von Čechtice, eines Anhängers der hussitischen Kirche. Der Band gelangte bald nach seiner Entstehung in Böhmen um 1500 in den Bestand der Wittenberger "Bibliotheca Electoralis", die größtenteils 1549 nach Jena kam. Er gehörte der Jenaer Bibliothek bis 1951 (Signatur: Ms. El. f. 50b). Auf Veranlassung der Staatsführung der DDR wurde er dann von dort entfernt und durch Wilhelm Pieck am 23. Oktober 1951 in Prag als Geschenk an das tschechische Volk überreicht. Heute wird er im Prager Nationalmuseum unter der Signatur IV B 24 verwahrt, ist aber wegen seiner Herkunft noch unter der Bezeichnung "Jenaer Kodex" bzw. "Jenaer Hussitenkodex" bekannt.
Nicht nur wegen der anspruchsvollen künstlerischen Ausstattung erlangte der Codex einen hohen Bekanntheitsgrad, sondern auch als Folge der prominenten Rezeptions- und Gebrauchsgeschichte (Luther und Cranach dürften die Handschrift gekannt haben, Goethe hat sie intensiv genutzt). Hinzu kommt, dass der Band (neben Cod. Ms. Theol. 182 der SUB Göttingen) zu den wenigen Zeugnissen des später im Zeichen der Gegenreformation systematisch zerstörten kulturellen Erbes der Hussitenbewegung zählt. Es sind vor allem die künstlerisch aufwendigen Illustrationen weiter Teile des Bandes in Form von paarweise angeordneten Bildantithesen, welche die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Hierbei handelt es sich um bildhaft umgesetzte Gegensatzpaare aus Darstellungen der christlichen Urgemeinschaft einerseits und der Geschichte der Kirchenhierarchie im Sinne antipäpstlicher Polemik andererseits. Mit dem Mittel der Bildagitation werden verschiedene Themenbereiche der hussitischen Kritik angesprochen: Kauf und Verkauf kirchlicher Ämter (Simonie), Reichtum der Kirche, moralischer Verfall der Geistlichen, Ablasshandel, Abendmahl sowie Stationen aus dem Leben und Werk des Kirchenreformators Jan Hus (um 1370–1415) und der hussitischen Bewegung. Vermutlich ging es bei der textlichen Abfassung und der künstlerischen Ausgestaltung des Hussitenkodex darum, eine Anthologie der schriftlichen und bebilderten Zeugnisse der Hussitenbewegung zusammenzustellen. Dies umso mehr, als der Band nicht vor oder unmittelbar während der Hussitenkriege (1419–1439) angefertigt wurde, sondern erst nach dem Tod des böhmischen Königs Georg von Podiebrad (1420–1471; tschechisch: Jirí z Podebrad), weshalb ihm der Rang einer dokumentarischen Quellensammlung des gemäßigten, also utraquistischen Flügels der Hussiten zukommt.
Nicht nur wegen der anspruchsvollen künstlerischen Ausstattung erlangte der Codex einen hohen Bekanntheitsgrad, sondern auch als Folge der prominenten Rezeptions- und Gebrauchsgeschichte (Luther und Cranach dürften die Handschrift gekannt haben, Goethe hat sie intensiv genutzt). Hinzu kommt, dass der Band (neben Cod. Ms. Theol. 182 der SUB Göttingen) zu den wenigen Zeugnissen des später im Zeichen der Gegenreformation systematisch zerstörten kulturellen Erbes der Hussitenbewegung zählt. Es sind vor allem die künstlerisch aufwendigen Illustrationen weiter Teile des Bandes in Form von paarweise angeordneten Bildantithesen, welche die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Hierbei handelt es sich um bildhaft umgesetzte Gegensatzpaare aus Darstellungen der christlichen Urgemeinschaft einerseits und der Geschichte der Kirchenhierarchie im Sinne antipäpstlicher Polemik andererseits. Mit dem Mittel der Bildagitation werden verschiedene Themenbereiche der hussitischen Kritik angesprochen: Kauf und Verkauf kirchlicher Ämter (Simonie), Reichtum der Kirche, moralischer Verfall der Geistlichen, Ablasshandel, Abendmahl sowie Stationen aus dem Leben und Werk des Kirchenreformators Jan Hus (um 1370–1415) und der hussitischen Bewegung. Vermutlich ging es bei der textlichen Abfassung und der künstlerischen Ausgestaltung des Hussitenkodex darum, eine Anthologie der schriftlichen und bebilderten Zeugnisse der Hussitenbewegung zusammenzustellen. Dies umso mehr, als der Band nicht vor oder unmittelbar während der Hussitenkriege (1419–1439) angefertigt wurde, sondern erst nach dem Tod des böhmischen Königs Georg von Podiebrad (1420–1471; tschechisch: Jirí z Podebrad), weshalb ihm der Rang einer dokumentarischen Quellensammlung des gemäßigten, also utraquistischen Flügels der Hussiten zukommt.
Literatur:
-- Zoroslava Drobná, Der Jenaer Kodex. Eine hussitische Bildsatire vom Ende des Mittelalters, Prag 1970
-- Bernhard Tönnies, Die Handschriften der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, Bd. 1: Die mittelalterlichen lateinischen
Handschriften der Electoralis-Gruppe, Wiesbaden 2002, S. 141 [siehe dort nach weiterführender Literatur]
-- Thomas Mutschler, Der Jenaer Kodex. Eine Handschriftenaffäre in der frühen DDR?, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (2009), Heft 2, S. 71-74
(online: http://dx.doi.org/10.3196/186429500956217)
-- Marta Vaculínová (Hrsg.), The Jena Codex. Bd. 1: facsimile. Bd. 2: commentary, Prag 2009
-- Joachim Ott, Hus - Luther - Cranach. Handschriften und Drucke der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, Jena 2015, S. 30-33
-- Bernhard Tönnies, Die Handschriften der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, Bd. 1: Die mittelalterlichen lateinischen
Handschriften der Electoralis-Gruppe, Wiesbaden 2002, S. 141 [siehe dort nach weiterführender Literatur]
-- Thomas Mutschler, Der Jenaer Kodex. Eine Handschriftenaffäre in der frühen DDR?, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (2009), Heft 2, S. 71-74
(online: http://dx.doi.org/10.3196/186429500956217)
-- Marta Vaculínová (Hrsg.), The Jena Codex. Bd. 1: facsimile. Bd. 2: commentary, Prag 2009
-- Joachim Ott, Hus - Luther - Cranach. Handschriften und Drucke der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, Jena 2015, S. 30-33
Lizenz:
Material:
braunes Leder über Holz
Einbandschmuck:
Die Ornamentik zeigt Rahmen aus Linien und Bändern, die mit Flechtwerk, einem Renaissance-Ornament und einer Pflanzenranke mit Blättchen und Blüten ausgefüllt sind. Die Vorderseite ist im Mittelfeld mit der Gestalt des Moses geschmückt, der die Gesetztafeln in den Händen hält und von einem rechteckigen Rahmen umgeben ist. Darüber ist in der Mitte ein Kelch zu sehen, das Symbol der inhaltlichen Tendenz des ganzen Sammelbandes.
Beschreibung des Einbandes:
Der Kodex ist in hölzerne Brettchen eingebunden. Die Tafeln sind mit braunem Leder bezogen, in das in Blindendruck ausgeführte Verzierungen eingepresst sind.
Der Einband war teilweise vergoldet und mit einem Beschlag mit Spangen versehen, der heute nicht mehr vorhanden ist. Nach dem Stilcharakter der Verzierungen, in denen sich bereits die Renaissance ankündigt, wird der Einband des Jenaer Kodex der Endphase des ersten Viertels des 16. Jh.s zugeordnet.
Der Einband war teilweise vergoldet und mit einem Beschlag mit Spangen versehen, der heute nicht mehr vorhanden ist. Nach dem Stilcharakter der Verzierungen, in denen sich bereits die Renaissance ankündigt, wird der Einband des Jenaer Kodex der Endphase des ersten Viertels des 16. Jh.s zugeordnet.
Schließen/Applikation:
ehemals Beschlag mit Spangen vorhanden gewesen
-
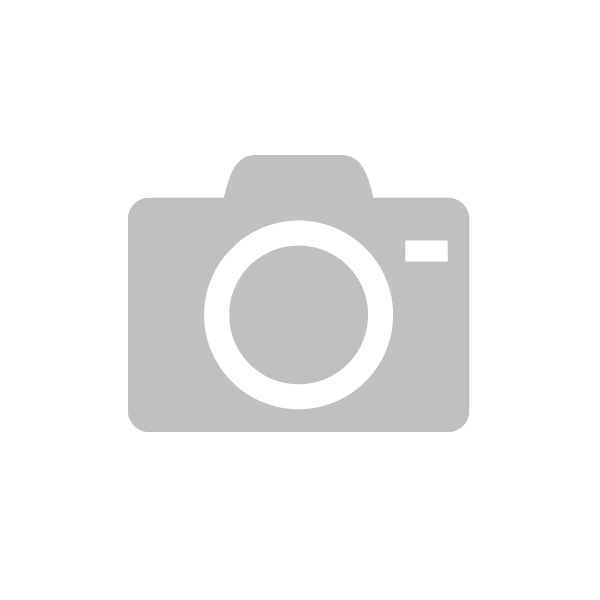
-
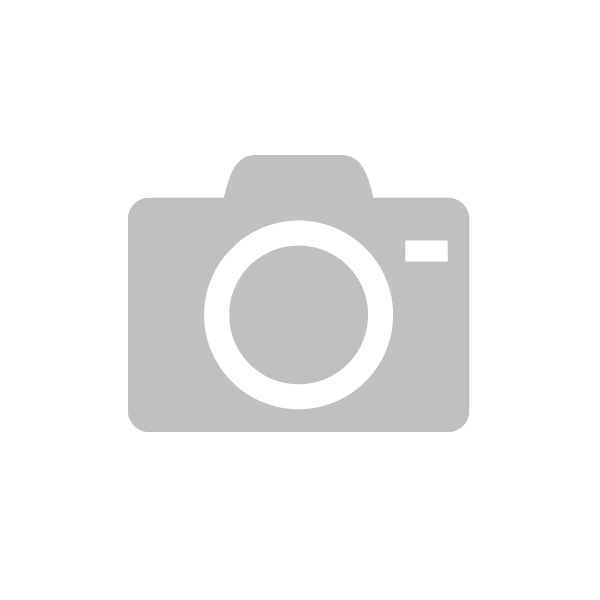 6v - 7v - leer
6v - 7v - leer5053491-9
-
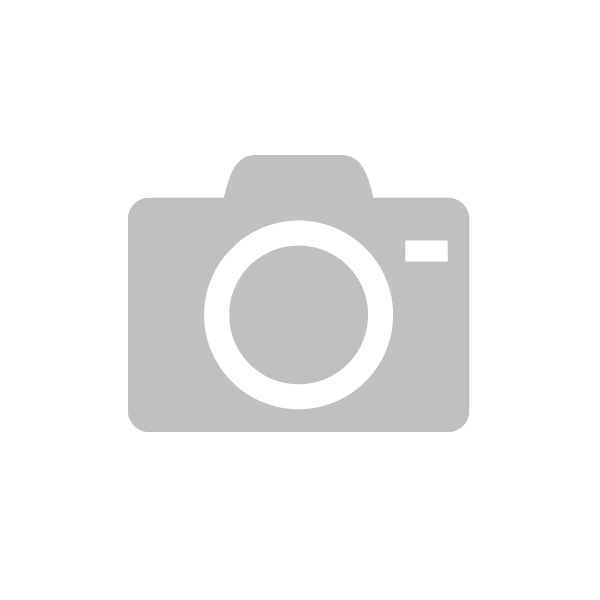
-
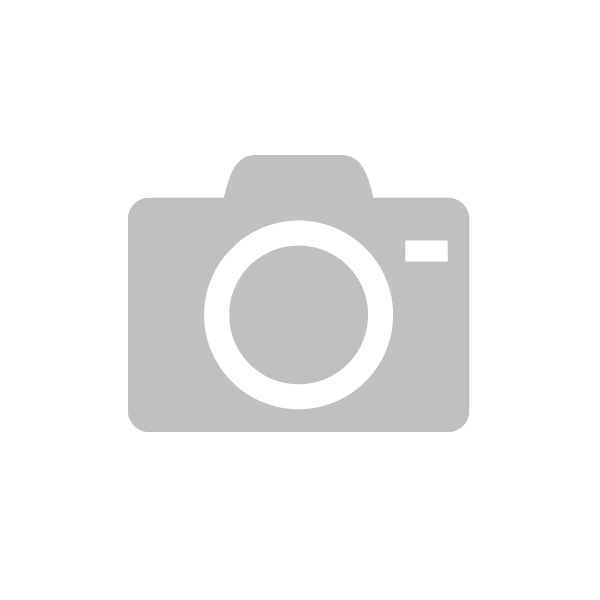 9r - leer
9r - leer5053491-9
-
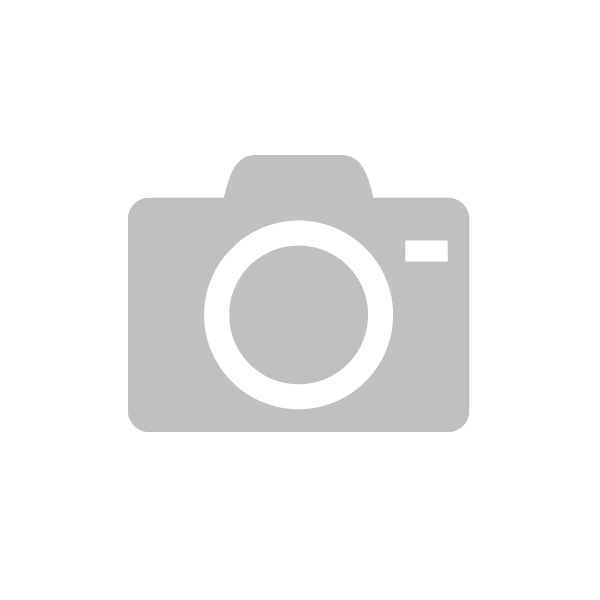 9v - Der Spiegel der Christenheit
9v - Der Spiegel der Christenheit5053491-9
-
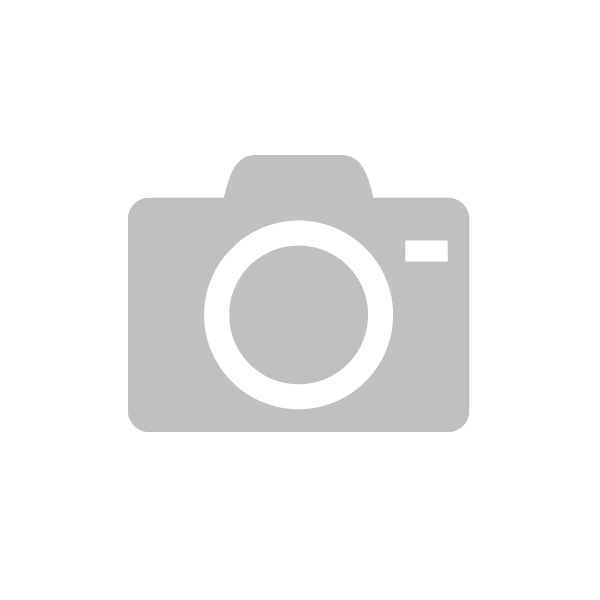 10r - leer
10r - leer5053491-9
-
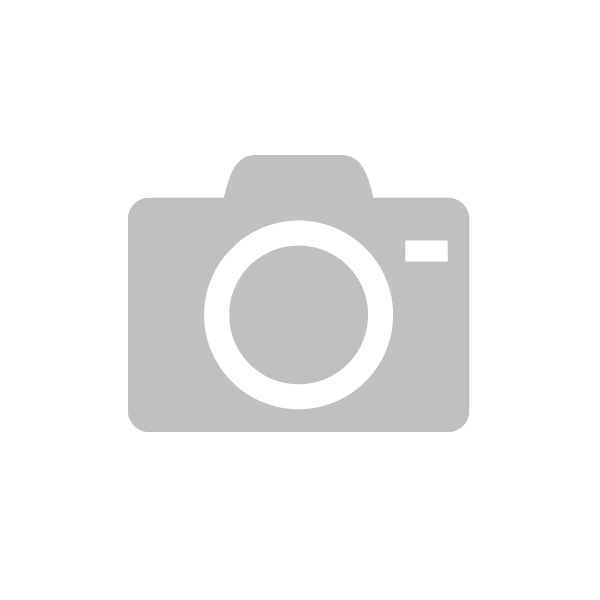
-
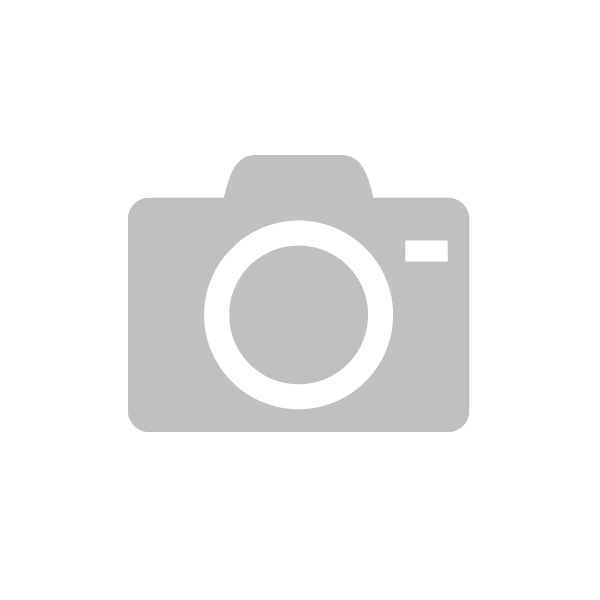 11r - Die Stadt Christi: Jerusalem
11r - Die Stadt Christi: Jerusalem5053491-9
-
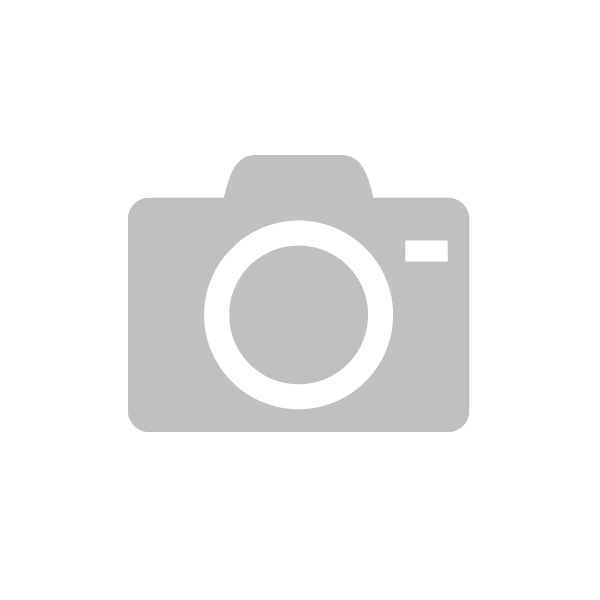 11v - leer
11v - leer5053491-9
-